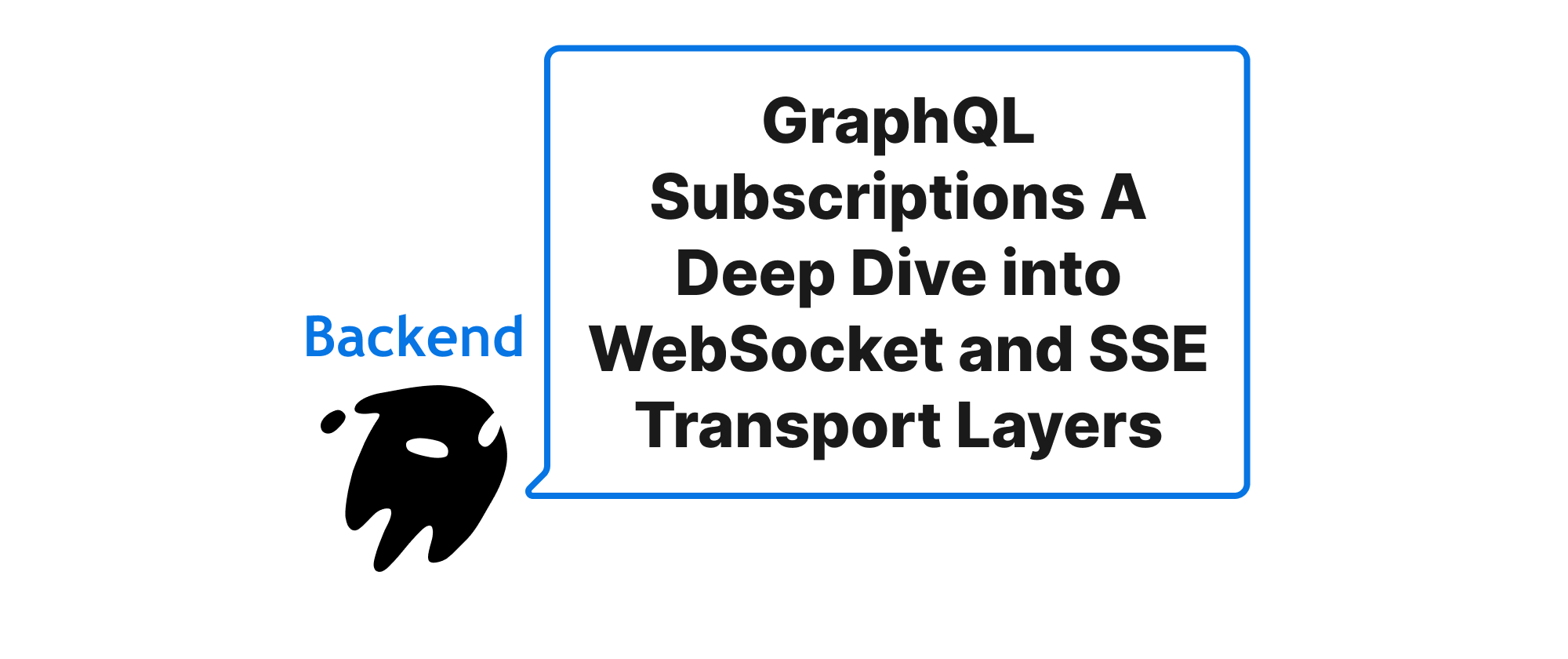Warum Ihr nächstes Projekt das modulare Monolith umarmen sollte
James Reed
Infrastructure Engineer · Leapcell
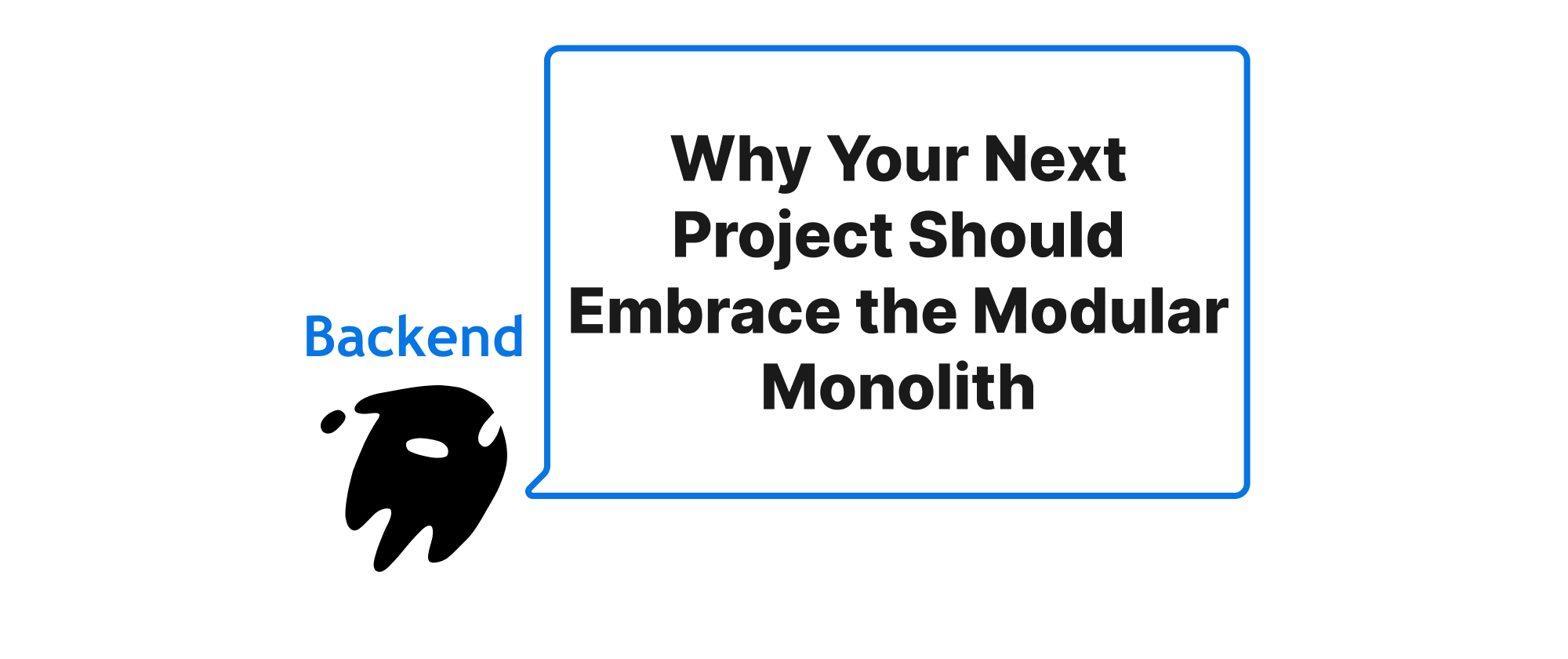
Einführung
In der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der Backend-Entwicklung ist die Verlockung von Microservices immens gewachsen. Das Versprechen unabhängiger Deployments, verbesserter Skalierbarkeit und diskreter Teams macht sie oft zur De-facto-Wahl für neue Projekte. Diese eifrige Annahme übersieht jedoch manchmal die inhärente Komplexität und den operativen Mehraufwand, den Microservices einführen, insbesondere in den frühen Phasen des Projektlebenszyklus. Dieser Artikel stellt eine überzeugende Alternative vor: den modularen Monolithen. Wir werden untersuchen, warum der Start mit einem modularen Monolithen oft eine pragmatischere, effizientere und letztendlich erfolgreichere Strategie für Ihr nächstes Backend-Projekt sein kann, und damit eine robuste Grundlage für zukünftige Skalierbarkeit und Weiterentwicklung legen, anstatt sofort in die komplizierte Welt der verteilten Systeme einzutauchen.
Die pragmatische Kraft des modularen Monolithen
Bevor wir uns mit dem "Warum" befassen, sollten wir ein gemeinsames Verständnis der Kernbegriffe entwickeln, die unsere Diskussion rahmen werden.
Monolith: Traditionell wird eine monolithische Anwendung als eine einzige, unteilbare Einheit aufgebaut. Alle Komponenten – Präsentation, Geschäftslogik und Datenzugriff – sind eng gekoppelt und laufen innerhalb eines einzigen Prozesses. Skalierung bedeutet oft, die gesamte Anwendung zu replizieren.
Microservices: Im Gegensatz dazu sind Microservices kleine, unabhängige Dienste, die jeweils in ihrem eigenen Prozess laufen und typischerweise über ein Netzwerk mit anderen kommunizieren. Jeder Dienst ist für eine bestimmte Geschäftsfähigkeit verantwortlich, kann von einem kleinen, autonomen Team entwickelt und unabhängig bereitgestellt werden.
Modularer Monolith: Dies ist kein traditioneller Monolith. Ein modularer Monolith ist eine einzelne Anwendung (ein Monolith), die intern mit klar definierten, unabhängigen Modulen strukturiert ist. Jedes Modul kapselt eine bestimmte Geschäftsfähigkeit mit klaren Grenzen, Schnittstellen und minimaler Kopplung zu anderen Modulen. Obwohl sie denselben Code und dieselbe Deployment-Einheit teilen, spiegeln ihre internen Designprinzipien die von Microservices wider.
Das Problem der vorzeitigen Microservices-Einführung
Viele Projekte stürzen sich voreilig in Microservices, angetrieben von dem Wunsch, "modern" zu sein oder der Annahme, dass sie von Natur aus überlegene Leistung und Skalierbarkeit bieten. Dies führt jedoch oft zu:
- Erhöhte Komplexität: Verteilte Systeme sind von Natur aus komplex. Die Verwaltung der Inter-Service-Kommunikation, die Gewährleistung der Datenkonsistenz über Dienste hinweg, verteiltes Tracing und Debugging über mehrere Deployment-Einheiten hinweg verursachen erheblichen Mehraufwand.
- Höhere operative Belastung: Das Deployment, die Überwachung und Skalierung einer Vielzahl von Diensten erfordert ausgefeilte CI/CD-Pipelines, Container-Orchestrierung und spezialisierte Werkzeuge. Dies ist eine beträchtliche Investition für ein neues Team oder Projekt.
- Steilere Lernkurve: Teams, die neu bei Microservices sind, werden viel Zeit mit dem Erlernen neuer Frameworks, Deployment-Strategien und Fehlerbehebungstechniken verbringen, anstatt sich auf die Bereitstellung von Geschäftswert zu konzentrieren.
- Reduzierte Entwicklungsgeschwindigkeit (anfänglich): Obwohl Microservices eine langfristige Entwicklungsgeschwindigkeit versprechen, können der anfängliche Setup- und Kommunikationsaufwand den Fortschritt erheblich verlangsamen.
Warum der modulare Monolith für neue Projekte glänzt
Der modulare Monolith bietet einen Sweet Spot und bietet viele der Vorteile von Microservices ohne deren anfängliche Komplexität:
-
Einfachheit des Deployments und Betriebs: Es ist eine einzelne Einheit. Das Deployment ist unkompliziert und die Überwachung, Protokollierung und das Debugging sind im Vergleich zu einem verteilten System erheblich einfacher. Dies ermöglicht es den Teams, sich auf das Erstellen von Funktionen zu konzentrieren, anstatt die Infrastruktur zu verwalten.
-
Gemeinsame Ressourcen und Kohäsion: Da alle Module im selben Prozess leben, sind direkte Funktionsaufrufe zwischen den Modulen möglich, wodurch Netzwerklatenz und Serialisierungsaufwand vermieden werden. Gemeinsam genutzte Bibliotheken und Dienstprogramme sind leicht zugänglich. Die Datenkonsistenz ist innerhalb einer einzelnen Datenbank oder eines gemeinsamen Transaktionskontexts einfacher zu verwalten.
-
Schnellere Entwicklungsgeschwindigkeit (anfänglich): Mit weniger beweglichen Teilen und einfacherer Kommunikation können Entwickler schneller iterieren, gründlicher testen und neue Teammitglieder schneller einarbeiten. Dies ist entscheidend, um eine Idee zu testen oder Product-Market-Fit zu erreichen.
-
Erzwungene Modularität und klare Grenzen: Das Kernprinzip eines modularen Monolithen ist die Durchsetzung strenger Grenzen zwischen den Modulen. Dies bereitet die Anwendung auf einen möglichen Übergang zu Microservices vor, da jedes Modul bereits ein Kandidat für die Extraktion in einen unabhängigen Dienst ist.
-
Einfaches Refactoring und übergreifende Belange: Das Refactoring interner Modulgrenzen ist in einer einzigen Codebasis viel einfacher als über netzwerkgetrennte Dienste hinweg. Die Implementierung übergreifender Belange wie Authentifizierung oder Protokollierung ist ebenfalls einfacher.
Aufbau eines modularen Monolithen: Praktische Implementierung
Der Schlüssel zu einem erfolgreichen modularen Monolithen liegt in einem disziplinierten Architekturdesign. Betrachten wir ein Beispiel mit Python und Flask, um zu zeigen, wie eine modulare Anwendung strukturiert werden kann.
Stellen Sie sich eine E-Commerce-Anwendung mit Modulen für Benutzer, Produkte und Bestellungen vor.
/
├── app.py # Haupt-Einstiegspunkt der Anwendung
├── config.py # Zentrale Konfiguration
├── common/ # Gemeinsame Dienstprogramme, Dienste, Abstraktionen
│ ├── __init__.py
│ ├── database.py # Datenbank-Sitzungsmanager, ORM-Basis
│ └── auth.py # Authentifizierungsdekorationen/Dienste
│
├── modules/
│ ├── __init__.py
│ │
│ ├── users/ # Benutzer-Modul
│ │ ├── __init__.py
│ │ ├── api.py # REST-API-Endpunkte für Benutzer
│ │ ├── models.py # Benutzer-Datenmodelle (z. B. SQLAlchemy)
│ │ ├── services.py # Geschäftslogik für Benutzer
│ │ └── schemas.py # Datenvalidierungs-/Serialisierungsmodelle (z. B. Marshmallow)
│ │
│ ├── products/ # Produkte-Modul
│ │ ├── __init__.py
│ │ ├── api.py
│ │ ├── models.py
│ │ ├── services.py
│ │ └── schemas.py
│ │
│ └── orders/ # Bestellungen-Modul
│ ├── __init__.py
│ ├── api.py
│ ├── models.py
│ ├── services.py
│ └── schemas.py
│
└── tests/
└── ... # Unit- und Integrationstests
app.py (Haupt-Einstiegspunkt der Anwendung):
from flask import Flask from common.database import init_db from modules.users.api import users_bp from modules.products.api import products_bp from modules.orders.api import orders_bp def create_app(): app = Flask(__name__) app.config.from_object('config.Config') init_db(app) # Datenbank oder ORM initialisieren # Blueprints für jedes Modul registrieren app.register_blueprint(users_bp, url_prefix='/users') app.register_blueprint(products_bp, url_prefix='/products') app.register_blueprint(orders_bp, url_prefix='/orders') @app.route('/') def index(): return "Welcome to the Modular Monolith E-commerce!" return app if __name__ == '__main__': app = create_app() app.run(debug=True)
modules/users/api.py (Benutzer-Modul API):
from flask import Blueprint, request, jsonify from modules.users.services import UserService from modules.users.schemas import UserSchema, LoginSchema from common.auth import jwt_required, generate_token users_bp = Blueprint('users', __name__) user_service = UserService() user_schema = UserSchema() login_schema = LoginSchema() @users_bp.route('/register', methods=['POST']) def register_user(): data = request.get_json() errors = user_schema.validate(data) if errors: return jsonify(errors), 400 user = user_service.create_user(data) return jsonify(user_schema.dump(user)), 201 @users_bp.route('/login', methods=['POST']) def login_user(): data = request.get_json() errors = login_schema.validate(data) if errors: return jsonify(errors), 400 user = user_service.authenticate_user(data['username'], data['password']) if user: token = generate_token(user.id) return jsonify(message="Login successful", token=token), 200 return jsonify(message="Invalid credentials"), 401 @users_bp.route('/profile', methods=['GET']) @jwt_required def get_user_profile(user_id): # user_id wird vom jwt_required-Dekorator injiziert user = user_service.get_user_by_id(user_id) if user: return jsonify(user_schema.dump(user)), 200 return jsonify(message="User not found"), 404
Wichtige Architekturprinzipien:
- Explizite Modulgrenzen: Jeder Ordner unter
modules/stellt eine eigenständige Geschäftsfähigkeit dar. Die Kommunikation zwischen den Modulen sollte hauptsächlich über klar definierte Schnittstellen erfolgen (z. B. ein Dienst in einem Modul ruft einen Dienst in einem anderen über eine öffentliche Methode auf) und nicht durch direkten Zugriff auf interne Modelle oder die Datenbank eines anderen Moduls. Die Verwendung eines internen Nachrichtenbusses (z. B. eines In-Memory-Ereignisverteilers) kann ebenfalls eine lose Kopplung erzwingen. - Kein direkter Datenbankzugriff zwischen Modulen: Die Datenbankmodelle eines Moduls sind intern für dieses Modul. Andere Module sollten nur über seine öffentlichen Dienste auf seine Daten zugreifen. Dies ermöglicht es jedem Modul, seinen internen Persistenzmechanismus zu ändern, ohne andere zu beeinträchtigen.
- Dependency Inversion: Höherwertige Module sollten nicht direkt von niedrigerwertigen Modulen abhängen. Stattdessen sollten sie von Abstraktionen (Schnittstellen/Protokollen) abhängen. Dies ermöglicht ein einfacheres Austauschen von Implementierungen und eine bessere Testbarkeit.
- Gemeinsamer Kern/gemeinsame Dienstprogramme: Wiederverwendbare Komponenten, die nicht zu einer bestimmten Geschäftsfähigkeit gehören (wie Datenbankverbindungen, Authentifizierungsdienstprogramme, Protokollierung, Konfiguration), befinden sich in einem
common- odercore-Verzeichnis.
Der Entwicklungspfad: Vom modularen Monolithen zu Microservices
Einer der überzeugendsten Vorteile eines modularen Monolithen ist sein natürlicher Entwicklungspfad zu Microservices. Wenn die Komplexität eines Moduls zunimmt, zu einem Leistungsengpass wird oder ein engagiertes Team es unabhängig besitzen muss, kann dieses klar definierte Modul in einen eigenen Dienst extrahiert werden.
Zum Beispiel könnte das Orders-Modul zu einem eigenständigen Order Service werden. Seine API-Endpunkte würden dieselbe Funktionalität bereitstellen, aber jetzt über HTTP/gRPC kommunizieren. Seine Datenbank könnte entkoppelt werden. Die internen Aufrufe würden durch Netzwerkanrufe ersetzt. Diese inkrementelle Extraktion ist weitaus weniger riskant und störend als der Versuch einer "Big Bang" Microservices-Neufassung.
Fazit
Für Ihr nächstes Projekt, insbesondere wenn die Produktanforderungen noch in der Entwicklung sind, die Teamgröße bescheiden ist oder die Betriebsexpertise begrenzt ist, ist der Start mit einem modularen Monolithen eine kluge und leistungsfähige Wahl. Er bietet die Agilität und Einfachheit einer monolithischen Architektur und vermittelt gleichzeitig die Disziplin und Struktur, die Ihre Anwendung auf zukünftiges Wachstum und potenzielle Microservice-Extraktion vorbereitet. Nutzen Sie den modularen Monolithen, um robuste, wartbare und sehr evolvierbare Backend-Systeme aufzubauen, ohne den vorzeitigen Mehraufwand verteilter Komplexität. Es ist der intelligente erste Schritt zu skalierbarer und nachhaltiger Softwareentwicklung.